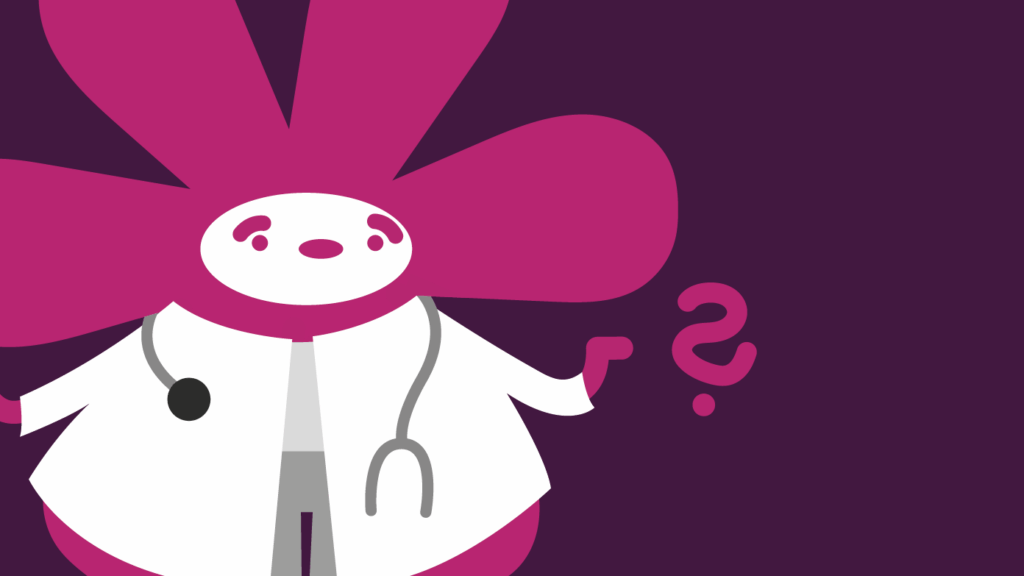Ein Jahr nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes zeigt sich eine widersprüchliche Realität. Die rechtliche Anerkennung wurde vereinfacht. Die Gesundheitsversorgung für TIN-Personen bleibt ein Problemfeld voller Diskriminierung und bürokratischer Hürden.
Das Selbstbestimmungsgesetz: Fortschritt mit Grenzen
Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) hat seit November 2024 die Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen erheblich erleichtert. Laut Bundesinnenministerium nutzten bis Ende Januar 2025 über 22.000 Menschen diese Möglichkeit. Das Gesetz beendete nach 44 Jahren das diskriminierende Transsexuellengesetz (TSG) und ermöglicht erstmals eine selbstbestimmte Änderung ohne pathologisierende Gutachten.
Das SBGG regelt ausschließlich das Personenstandsrecht. Eine Reform des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, das die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung regelt, fand nicht statt. Diese bewusste Entkopplung von rechtlicher Anerkennung und medizinischem Leistungsanspruch ist der Kern der gesundheitspolitischen Problemlage.
Trans* Personen werden gezwungen, sich gegenüber der Krankenkasse als krank im Sinne einer psychischen Störung zu definieren, um einen Leistungsanspruch zu begründen. Gleichzeitig sind sie rechtlich als gesund anerkannt. Dieses Paradoxon prägt die Versorgungsrealität 2025.
Rechtliche Unsicherheit durch BSG-Urteil
Ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 19. Oktober 2023 (Az. B 1 KR 3/22 R) hat die Situation verschärft. Das Gericht stufte moderne, leitliniengerechte geschlechtsaffirmierende Versorgung als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode ein. Diese dürfen nur dann von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss zuvor den Nutzen positiv bewertet hat. Eine solche Bewertung liegt nicht vor.
Besonders betroffen hinsichtlich der Gesundheitsversorgung für TIN-Personen sind nichtbinäre Menschen. Für sie erkannte das Bundessozialgericht keine Kostenübernahme an, da es keinen nichtbinären Phänotyp gebe. Diese Argumentation ignoriert die wissenschaftliche Evidenz. Die AWMF-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter sowie die Langfassung der S3-Leitlinie schließen nichtbinäre Identitäten ausdrücklich ein und betonen, dass geschlechtsaffirmierende Maßnahmen nicht an binäre Geschlechtsidentitäten gebunden sind.
Das Urteil spaltet die trans* Community juristisch. Personen mit Behandlungsbeginn vor Oktober 2023 genießen möglicherweise noch Schutz. Neufälle nach diesem Datum stehen vor Unsicherheit. Nichtbinäre Personen sind definitiv ausgeschlossen, obwohl sie laut der Schätzung des LSVD etwa ein Drittel der trans* Community ausmachen.
Widerspruch zwischen medizinischer Ethik und Kassenpraxis
In der Praxis der gesetzlichen Krankenversicherung existieren zwei widersprüchliche Regelwerke. Die AWMF-Leitlinien definieren den medizinischen Goldstandard. Sie sind partizipativ ausgerichtet und schließen nichtbinäre Identitäten ein. Eine verpflichtende Psychotherapie als Voraussetzung für geschlechtsangleichende Maßnahmen ist laut Leitlinie weder mit dem aktuellen Fachwissen noch mit berufsethischen Grundsätzen vereinbar.
Der Medizinische Dienst nutzt zur Begutachtung von Anträgen weiterhin seine Begutachtungsanleitung Transsexualismus von 2020. Diese basiert auf der obsoleten ICD-10-Diagnose F64.0 und verteidigt Alltagserfahrungen als Voraussetzung für Operationen. Die AWMF lehnt diese als disziplinierend und risikoreich ab.
Dieser Widerspruch zwischen medizinischer Ethik und Kassenbürokratie führt dazu, dass Anträge nicht abgelehnt werden, weil sie medizinisch unnötig sind, sondern weil sie formal unvollständig gemäß der veralteten Checkliste sind. Nichtbinäre Menschen trifft dies besonders hart, da die Begutachtungsanleitung ausschließlich binäre Transidentitäten berücksichtigt.
Hormontherapie: Lange Wartezeiten und regionale Unterschiede
Der Zugang zur Hormontherapie ist durch ein komplexes System aus Indikationsschreiben, ärztlichen Bewilligungen und Krankenkassenanträgen geprägt. Laut einer Studie im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums von 2023 vergehen durchschnittlich acht bis zwölf Monate vom ersten Therapiekontakt bis zum Beginn der Hormontherapie.
Regional gibt es massive Unterschiede bei der Gesundheitsversorgung für TIN-Personen. Während in Großstädten wie Berlin teilweise innerhalb von zwei bis drei Monaten eine Hormontherapie begonnen werden kann, berichten Betroffene aus ländlichen Regionen von Wartezeiten von zwei Jahren und mehr.
Diese Wartezeiten stellen eine enorme psychische Belastung dar. Viele Betroffene weichen deshalb auf DIY-Hormontherapie aus, was erhebliche gesundheitliche Risiken birgt.
Für nichtbinäre Menschen stellt sich zusätzlich die Frage nach individuell angepassten Hormontherapien. Nicht alle nichtbinären Menschen streben eine vollständige Maskulinisierung oder Feminisierung an. Die AWMF-Leitlinie erkennt dies an und empfiehlt flexible Dosierungen. In der Praxis stoßen Betroffene jedoch auf Ärzt*innen, die nur Standardprotokolle kennen oder bereit sind anzuwenden.
Geschlechtsangleichende Operationen: Entwürdigende Bedingungen
Seit dem Bundessozialgericht-Urteil von 2023 herrscht massive Unsicherheit über die Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Operationen. Krankenkassen nutzen die unklare Rechtslage, um höhere Anforderungen zu stellen und Anträge häufiger abzulehnen.
Betroffene berichten von entwürdigenden Bedingungen. Krankenkassen verlangen Hautarztbefunde für Haarentfernung, Gewichtsverlust vor Operationen und den Nachweis einer stabilen Psyche. Alte Diagnosen wie Depressionen oder Autismus werden gegen Antragstellende verwendet, obwohl sie mit der Transidentität nichts zu tun haben.
Die Wartezeiten für genitalangleichende Operationen betragen an spezialisierten Kliniken fünf bis sechs Monate für trans* Frauen und noch länger für trans* Männer. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2023 bundesweit 3.075 geschlechtsangleichende Eingriffe am Genital durchgeführt, ein Zuwachs von 18 Prozent gegenüber 2022.
Nichtbinäre Menschen stehen vor zusätzlichen Hürden hinsichtlich der Gesundheitsversorgung für TIN-Personen. Viele streben keine vollständige genitalangleichende Operation an, sondern einzelne Eingriffe wie Mastektomie, Hysterektomie oder Orchiektomie. Das BSG-Urteil von 2023 verneint für sie jedoch jeglichen Anspruch. Betroffene müssen entweder eine binäre trans* Identität vortäuschen oder die Kosten selbst tragen. Eine Mastektomie kostet privat zwischen 5.000 und 8.000 Euro, eine Hysterektomie zwischen 3.000 und 6.000 Euro.
Haarentfernung: Systemversagen mit Ansage
Ein besonders eklatantes Beispiel für die Diskrepanz zwischen Recht und Praxis ist die dauerhafte Haarentfernung mittels Nadelepilation. Das Bundessozialgericht entschied am 27. Februar 2020 (Az. B 1 KR 15/19 R), dass die Krankenkassen die Kosten nur übernehmen müssen, wenn die Behandlung von Ärzt*innen durchgeführt wird. Praktisch keine Vertragsärzt*innen bieten diese Leistung an, da sie sich wirtschaftlich nicht lohnt.
Die Behandlung erfordert 150 bis 300 Stunden über zwei bis fünf Jahre und kostet bei privaten Kosmetikerinnen etwa 100 Euro pro Stunde, also insgesamt 15.000 bis 30.000 Euro. Betroffene müssen den Krankenkassen nachweisen, dass kein Arzt die Behandlung durchführt, indem sie etwa zehn Ärzt*innen abklappern und Absagen dokumentieren.
Das Problem der unzureichenden Gesundheitsversorgung für TIN-Personen ist seit Jahren bekannt, führt aber zu keiner politischen Lösung. Diese Unterversorgung ist besonders perfide, weil sie trans* Frauen sichtbarer für Diskriminierung und Gewalt macht. Nichtbinäre Menschen mit weiblichem Zuweisungsgeschlecht sind von diesem Problem nicht betroffen, nichtbinäre Menschen mit männlichem Zuweisungsgeschlecht jedoch sehr wohl, sofern sie eine Feminisierung anstreben.
Versorgung von Jugendlichen: Zwischen Leitlinien und Politik
Die Versorgung von trans* Jugendlichen wird maßgeblich durch die neue S2k-Leitlinie geprägt, die im März 2025 finalisiert wurde. Die Leitlinie befürwortet den Zugang zu Pubertätsblockern und geschlechtsangleichender Hormonbehandlung, fordert aber eine umfangreiche jugendpsychiatrische Diagnostik.
Pubertätsblocker verzögern reversibel die körperliche Entwicklung, um Jugendlichen Zeit für Entscheidungen zu verschaffen. Nach Absetzen der Medikamente setzt sich die Pubertät fort. Eine Langzeitstudie der American Academy of Pediatrics von 2022 betont die positiven Effekte auf die psychische Gesundheit.
Die praktischen Hürden für trans* Jugendliche sind enorm. Spezialisierte Sprechstunden sind nicht flächendeckend vorhanden, Wartezeiten von ein bis zwei Jahren keine Seltenheit. Minderjährige ab 14 Jahren benötigen die Zustimmung ihrer Sorgeberechtigten. Bei nicht unterstützenden Eltern kann dies die Transition um Jahre verzögern oder verhindern.
Nichtbinäre Jugendliche stehen vor zusätzlichen Herausforderungen. Viele Behandelnde sind unsicher, wie sie mit nichtbinären Identitäten umgehen sollen. Die Leitlinie erkennt nichtbinäre Identitäten zwar an, in der Praxis fehlt es jedoch an Erfahrung und Bereitschaft, individualisierte Behandlungspfade zu entwickeln. Laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts von 2024 identifizieren sich etwa 40 Prozent der jungen trans* Menschen als nichtbinär.
Diskriminierung in der Regelversorgung
Trans*, inter* und nichtbinäre Menschen erleben systematische Diskriminierung im allgemeinen Gesundheitswesen. Die EU-LGBTI-Erhebung II von 2020 zeigt, dass 20 Prozent der trans* Personen in Deutschland im Gesundheitswesen diskriminiert wurden. Dies umfasst falsche Anrede im Wartezimmer, offene Beleidigung, Verweigerung von Behandlung und mangelndes Fachwissen bei Ärzt*innen.
Nichtbinäre Menschen erleben spezifische Formen der Diskriminierung. Viele medizinische Formulare kennen nur die Kategorien männlich und weiblich. Elektronische Patientenakten sind nicht auf nichtbinäre Geschlechtseinträge vorbereitet. Ärzt*innen reagieren oft mit Unverständnis oder Ablehnung auf nichtbinäre Identitäten.
Diese Diskriminierungserfahrungen führen dazu, dass trans* Menschen Arztbesuche vermeiden und notwendige medizinische Versorgung nicht in Anspruch nehmen. Die Folgen sind erhöhte Raten von unbehandelten Erkrankungen, chronischen Schmerzen und psychischen Problemen.
Intergeschlechtliche Personen: Die vergessene Dimension
Intergeschlechtliche Personen stellen eine im Sozialgesetzbuch weitgehend vergessene Gruppe dar. Die Gesetzgebung der letzten Jahre fokussierte sich bei Intergeschlechtlichkeit fast ausschließlich auf den Schutz von Kindern vor nicht konsensuellen Eingriffen. Das Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung von 2021 verbietet geschlechtsverändernde Operationen an Kindern ohne deren Einwilligung.
Es existieren keine klaren Regelungen für erwünschte, selbstbestimmte, geschlechtsaffirmierende oder medizinisch indizierte Behandlungen für inter* Personen. Sie fallen durch alle Raster. Sie sind nicht transsexuell im Sinne der ICD-10 und passen daher nicht in die Begutachtungsstruktur des Medizinischen Dienstes.
Inter* Personen müssen entweder eine falsche trans* Diagnose anstreben, um überhaupt in den Begutachtungsprozess zu gelangen, oder ihre Anträge werden als unzuständig abgetan.

Die dgti unterstützt Dich
Die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit setzt sich als Fachgesellschaft seit Jahrzehnten für die Rechte und die Gesundheitsversorgung von trans*, inter* und nichtbinären Menschen ein. Unsere Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Expertise, politischer Advocacy und direkter Unterstützung Betroffener.
Wenn Du Fragen zur Gesundheitsversorgung hast, Unterstützung bei Anträgen an Krankenkassen benötigen oder Hilfe bei Widerspruchsverfahren suchen, stehen Dir unsere Beratungsstellen bundesweit zur Verfügung. Unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Berater*innen verfügen über langjährige Erfahrungen und kennen die Fallstricke des Systems.
Diese Arbeit ist nur durch Deine Unterstützung möglich. Mit einer Spende oder Fördermitgliedschaft ermöglicht Ihr uns, weiterhin für bessere Versorgungsstrukturen zu kämpfen, politische Lobbyarbeit zu leisten und Betroffene direkt zu unterstützen. Jeder Beitrag zählt und trägt dazu bei, die Lücken zwischen Recht und Realität zu schließen.
Gemeinsam für eine selbstbestimmte Gesundheitsversorgung.