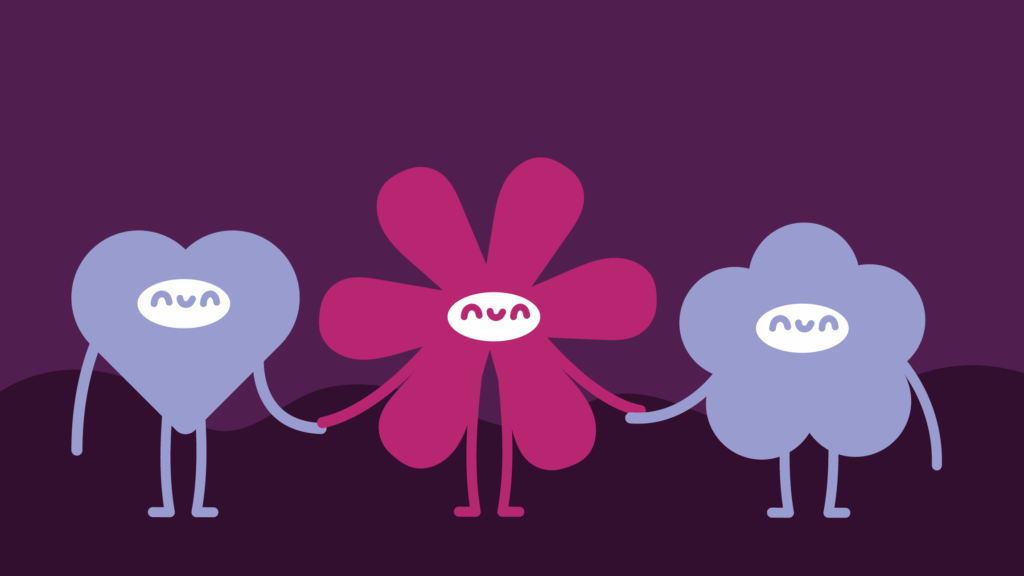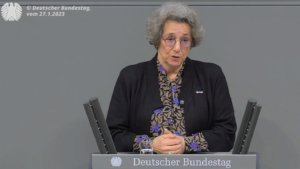Der Begriff „trans*“ ist heute in vielen gesellschaftlichen Bereichen präsent. Trans* zu sein, beschreibt Menschen, die sich nicht oder nicht ausschließlich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort „trans“ ab, das „jenseits“ oder „hinüber“ bedeutet.
Das Sternchen (Asterisk) ist ein wichtiger Platzhalter. Es symbolisiert die Vielfalt des Spektrums und schafft Raum für alle Selbstbezeichnungen. Es schließt binäre Identitäten wie trans* Männer und trans* Frauen ebenso ein wie nicht binäre Identitäten. Das Sternchen verlagert die Definitionsmacht weg von äußeren medizinischen oder rechtlichen Autoritäten hin zur individuellen Selbstbeschreibung.
Die Debatten um das neue Selbstbestimmungsgesetz haben die Sichtbarkeit erhöht, aber auch Fragen und Unsicherheiten offenbart. Dieser Artikel gibt einen sachlichen Überblick über zentrale Begriffe, rechtliche Rahmenbedingungen und die Lebensrealitäten von trans* Personen in Deutschland.
Von „Transsexuell“ zu „Transident“: Die Wichtigkeit der Sprache
Sprache prägt das Verständnis. Historisch ist der Begriff „transsexuell“ tief im medizinischen und juristischen Kontext verankert. Er bildete die Grundlage für das alte Transsexuellengesetz (TSG) und die veraltete Diagnose (ICD-10) einer „psychischen Störung“.
Viele trans* Personen lehnen diesen Begriff heute ab. Die Endung „sexuell“ ist irreführend. Sie stellt fälschlicherweise eine Verbindung zur sexuellen Orientierung her, obwohl es um die Geschlechtsidentität geht.
Als bewusste Alternative hat sich der Begriff „transident“ etabliert. Er ersetzt „sexuell“ durch „ident“ und rückt damit das Kernkonzept korrekt ins Zentrum: die Identität. Die dgti e. V. bevorzugt daher Begriffe wie „Transidentität“ oder „Transgeschlechtlichkeit“.
Mehr als Mann und Frau: Das Trans* Spektrum
Trans* ist ein Überbegriff für ein breites Spektrum von Identitäten. Eine gängige Unterscheidung ist die zwischen binären und nicht binären Identitäten.
Binäre Identitäten
Binäre trans* Personen identifizieren sich klar innerhalb des zweigeschlechtlichen Systems:
- Trans Frauen* sind Personen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde (AMAB), die sich aber als Frauen identifizieren.
- Trans Männer* sind Personen, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde (AFAB), die sich aber als Männer identifizieren.
Nicht binäre Identitäten
Nicht binär (oder „Enby“) ist ein Sammelbegriff für Menschen, deren Geschlechtsidentität außerhalb dieses Mann Frau Schemas liegt. Ihre Identität kann dazwischen, jenseits oder außerhalb des binären Systems liegen. Vielfältige Selbstbezeichnungen fallen darunter, zum Beispiel:
- Agender: Menschen, die sich als geschlechtsneutral oder ohne Geschlecht empfinden.
- Genderfluid: Personen, deren Geschlechtsidentität sich über die Zeit oder je nach Situation ändert.
Was Trans*-Sein nicht ist: Identität vs. Orientierung
Ein häufiges Missverständnis ist die Verwechslung von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung. Diese beiden Aspekte sind voneinander unabhängig.
- Geschlechtsidentität ist das innere Wissen einer Person über das eigene Geschlecht. Sie betrifft die Frage: „Wer bin ich?“.
- Sexuelle Orientierung beschreibt, zu welchem Geschlecht oder welchen Geschlechtern sich eine Person emotional oder sexuell hingezogen fühlt. Sie betrifft die Frage: „Wen liebe ich?“.
Eine trans* Person kann, genau wie eine cis Person, jede sexuelle Orientierung haben: heterosexuell, homosexuell (schwul oder lesbisch), bisexuell, asexuell oder pansexuell. Ein trans* Mann, der Männer liebt, ist schwul. Eine trans* Frau, die Frauen liebt, ist lesbisch.
Transition: Individuelle Wege zur Angleichung
Transition beschreibt den Prozess, das eigene Leben stärker in Einklang mit der Geschlechtsidentität zu bringen. Dieser Prozess ist hochgradig individuell. Es gibt keinen „richtigen“ Weg, und nicht jede trans* Person wünscht oder benötigt alle Schritte.
Die Transition hat verschiedene Dimensionen:
- Soziale Transition: Dies ist oft der erste Schritt und umfasst das Coming-out im sozialen Umfeld. Dazu gehört die Verwendung des selbstgewählten Namens und der korrekten Pronomen sowie die Anpassung des Geschlechtsausdrucks (Kleidung, Frisur).
- Rechtliche Transition: Die formale Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags in offiziellen Dokumenten.
- Medizinische Transition: Diese Schritte sind optional und können Hormontherapien, Logopädie zur Stimmveränderung oder geschlechtsangleichende Operationen umfassen.
Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG): Ein Wandel des Verfahrens
Am 1. November 2024 trat in Deutschland das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) in Kraft. Es ersetzt das über 40 Jahre alte Transsexuellengesetz (TSG).
Dieser Wechsel markiert einen Übergang von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung im rechtlichen Verfahren.
- Das alte TSG (bis 2024): Das Verfahren war ein langwieriger und teurer Gerichtsprozess. Betroffene mussten zwei voneinander unabhängige, invasive psychologische Gutachten vorlegen. Die Kosten beliefen sich oft auf Tausende von Euro. Das Verfahren war für viele „psychisch belastend“.
- Das neue SBGG (ab 2024): Das SBGG macht die Änderung zu einem reinen Verwaltungsakt beim Standesamt. Die demütigenden Zwangsgutachten und das Gerichtsverfahren entfallen. Eine Person muss die Änderung drei Monate im Voraus anmelden und dann persönlich beim Standesamt mit einer einfachen Erklärung bestätigen. Als Geschlechtseinträge sind „männlich“, „weiblich“, „divers“ oder „keine Angabe“ möglich.

Herausforderungen im System: Das rechtliche Limbo
Während das SBGG das Zivilrecht modernisiert hat, besteht im Sozialrecht eine massive Lücke. Die Kostenübernahme für medizinische Maßnahmen durch die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) basiert weiterhin auf der veralteten ICD-10 Diagnose „Transsexualismus“ (F64.0).
Diese Diagnose ist an ein binäres Verständnis gekoppelt. Für nicht binäre Personen hat dies gravierende Folgen. Das Bundessozialgericht urteilte im Oktober 2023, dass geschlechtsangleichende Operationen für nicht binäre Personen aktuell keine Kassenleistung sind.
Diese Rechtslage schafft eine Zwei Klassen Medizin. Sie zwingt nicht binäre Menschen, die medizinische Schritte benötigen, entweder zur Lüge (sich als binär auszugeben) oder zum Verzicht auf notwendige Versorgung.
Gleichzeitig hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Transidentität in der neuen ICD-11 längst entpathologisiert. Dort wird sie als „Gender Incongruence“ (Geschlechtsinkongruenz) geführt, nicht mehr als psychische Störung. Eine Anpassung des deutschen Sozialrechts an diese Realität steht aus.
Lebensrealitäten: Zwischen Euphorie und Diskriminierung
Die DJI Studie „Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung“ (2024) gibt Einblicke in die Lebensrealitäten junger trans* Personen. Sie beleuchtet nicht nur den Leidensdruck (Geschlechtsdysphorie), sondern betont auch die „Geschlechtseuphorie“. Dies beschreibt das tiefe Glücksgefühl, wenn die eigene Identität anerkannt wird und im Einklang mit dem Leben steht.
Gleichzeitig erleben trans* Personen massive Diskriminierung. Sie sind überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung betroffen. Transfeindliche Narrative, die von einer „Gender-Ideologie“ oder einem „Trans-Hype“ sprechen, verschärfen die gesellschaftliche Debatte. Die steigenden Zahlen von trans* Personen in Beratungsstellen sind jedoch kein „Trend“. Sie sind ein Zeichen gestiegener Sichtbarkeit und Akzeptanz, die es mehr Menschen ermöglichen, sich zu outen.

Unterstützung im Prozess
Der Weg der Transition und das Leben als trans* Person kann Unterstützung erfordern. Der Ergänzungsausweis der dgti e.V. ist ein wichtiges Instrument, das auch nach Einführung des SBGG relevant bleibt. Er hilft, die dreimonatige Wartezeit zu überbrücken oder den neuen Namen im Alltag zu erproben, bevor der rechtliche Schritt vollzogen wird.
Volle gesellschaftliche Akzeptanz ist noch nicht erreicht. Wissen, Sichtbarkeit und klare rechtliche Rahmenbedingungen fördern ein selbstbestimmtes Leben.
Benötigst Du Unterstützung oder Beratung zu Deiner Transition, dem Selbstbestimmungsgesetz oder dem Ergänzungsausweis? Die dgti e.V. und ihre angeschlossenen Beratungsstellen bieten bundesweit professionelle und ehrenamtliche Peer-Beratung an.
Die dgti e. V. setzt sich ehrenamtlich und unabhängig für die Rechte von trans*, inter* und nicht-binären Personen ein.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf zwei Wegen tun: Mit einer Spende, die unsere Projekte und die politische Arbeit für faire Verfahren und bessere Versorgung stärkt. Oder mit einer Fördermitgliedschaft, die unsere Stimme dauerhaft festigt und uns hilft, echte Gleichberechtigung zu erreichen.