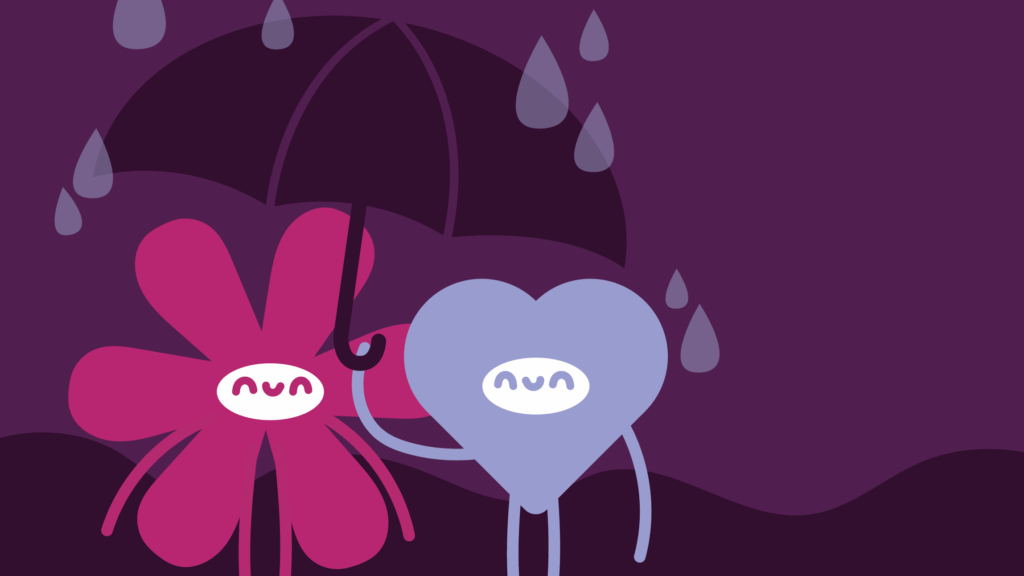Resilienz bedeutet seelische Widerstandskraft: also die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Für trans*, inter* und nicht-binäre (TIN*) Menschen ist sie kein Trendwort, sondern oft eine alltägliche Herausforderung. Das betrifft das Leben, den Umgang mit anderen und den Beruf.
Minderheitenstress: Wenn Belastung Alltag ist
Viele Studien zeigen, dass TIN* Personen häufiger psychische Belastungen erleben als cisgeschlechtliche Menschen. In einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gaben rund 40 Prozent der befragten trans Personen an, an Angststörungen zu leiden. Depressive Symptome treten doppelt so oft auf wie im Durchschnitt. (DIW, 2021)
Die Ursachen liegen selten bei den Betroffenen selbst. Forschende sprechen von Minderheitenstress: dem dauerhaften Druck, der durch Ausgrenzung, Vorurteile und das ständige Erklären der eigenen Identität entsteht. Dieser Stress wirkt oft unsichtbar und kann auch in scheinbar neutralen Situationen entstehen, etwa beim Arztbesuch oder im Job.
Die Arbeitswelt: Offenheit bleibt ein Risiko
Die von der dgti e. V. mitinitiierte Studie „TIN*klusiv im Office?!“ (Heiligers & Frohn, 2024) zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen am Arbeitsplatz nicht offen über ihre Identität sprechen. Nur ein kleiner Teil erlebt ein wirklich unterstützendes Umfeld. Viele berichten von Benachteiligungen, unangenehmen Fragen oder sogar Mobbing.
Dabei gilt: Je sicherer jemand im Job sein kann, desto besser sind Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Resilienz ist also nicht nur eine individuelle Aufgabe. Sie hängt auch davon ab, ob ein Arbeitsplatz wirklich inklusiv ist.
Ein Beispiel: Einige Unternehmen haben interne Diversity-Gruppen gegründet, die Beschäftigte mit ähnlichen Erfahrungen zusammenbringen. Dort werden Themen wie Coming-out, Sprache im Büro oder der Umgang mit Kundschaft offen besprochen. Andere Firmen bieten anonyme Ansprechstellen für Diskriminierung oder verpflichtende Schulungen für Führungskräfte an. Solche Maßnahmen tragen dazu bei, Stress zu verringern und ein Gefühl von Sicherheit aufzubauen. Das stärkt nicht nur die betroffenen Mitarbeitenden, sondern das gesamte Team.
Drei Wege, Resilienz zu stärken
Resilienz kann man trainieren. Drei Bereiche sind besonders wichtig.
1. Selbstfürsorge
Selbstfürsorge ist für TIN* Personen kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es geht darum, gut mit sich selbst umzugehen und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das kann heißen, Pausen zu machen, Grenzen zu setzen oder einfach Dinge zu tun, die guttun.
Hilfreich sind kleine Rituale wie ein Dankbarkeitstagebuch oder das bewusste Wahrnehmen eigener Stärken, etwa mit einer Ressourcen-Landkarte (PH NÖ Toolbox Resilienz). Auch die körperliche Selbstbestimmung spielt eine Rolle: Kleidung, Bewegung oder kreative Ausdrucksformen können helfen, sich im eigenen Körper wohler zu fühlen.
2. Gemeinschaft
Gemeinschaft ist ein starker Schutzfaktor. Menschen, die sich mit der Community verbunden fühlen, berichten seltener von Einsamkeit und Selbstzweifeln. (Franzen & Scheifele, 2023)
Peer-Gruppen, Selbsthilfe oder Online-Communities bieten Raum für Austausch und gegenseitige Stärkung. Auch im Job können Allies viel bewirken, also Menschen, die respektvoll ansprechen, richtig gendern und offen unterstützen. Wo solche Strukturen wachsen, verbessert sich das Arbeitsklima für alle.
3. Selbstwirksamkeit
Resilienz entsteht auch durch das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können. Das kann klein anfangen: sich informieren, Rechte kennen, eigene Grenzen klar machen.
Hilfreiche Quellen sind das dgti Ratgeberarchiv, Gespräche mit Peer-Beratenden oder der Austausch in Netzwerken. Auch das Korrigieren einer Fehlansprache oder das offene Einfordern korrekter Pronomen sind Schritte, die Selbstwirksamkeit stärken.

Verantwortung teilen
Resilienz ist kein Privatthema. Sie braucht faire Bedingungen. Arbeitgeber können viel beitragen, wenn sie Diskriminierung klar benennen, Ansprechpersonen schulen und inklusive Sprache fördern.
In der dgti-Studie berichten nur etwa zehn Prozent der Befragten, dass ihre Organisation gezielt Vielfalt fördert. Dabei profitieren alle: weniger Krankheitsausfälle, mehr Motivation, bessere Zusammenarbeit.
Hilfe und Unterstützung
Niemand muss alleine stark sein. Die dgti e. V. bietet bundesweit Peer-Beratung, Selbsthilfegruppen und fachliche Begleitung für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen.
Mehr Informationen finden sich hier:
Die dgti e. V. arbeitet ehrenamtlich und unabhängig für die Rechte von trans*, inter* und nicht-binären Personen.
Wenn du unsere Arbeit stärken möchtest, gibt es zwei einfache Wege:
- Spende für unsere politische Arbeit: Jeder Beitrag unterstützt unsere Projekte für faire Verfahren und eine bessere Versorgung.
- Werde Fördermitglied: Mit deiner Mitgliedschaft stärkst du unsere Stimme langfristig. Gemeinsam erreichen wir mehr.